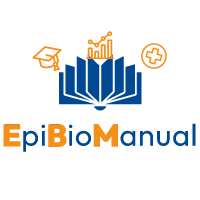Um Verzerrungen der Studienergebnisse durch Erwartungshaltungen der Patient:innen zu vermeiden, sollten diese in Interventionsstudien nicht über die bei ihnen eingesetzte Therapie informiert sein. Man spricht von einem blinden Studiendesign im Vergleich zu einem offenen Studiendesign, bei dem alle an der Studie beteiligten Personen über die Gruppenzugehörigkeit Bescheid wissen. Im Idealfall sind bei einer doppelblinden Studie zusätzlich zu den Studienteilnehmer:innen auch die Studienärzt:innen nicht über die Gruppenzugehörigkeit informiert, um Unterschiede in der Behandlung zwischen Interventions- und Kontrollgruppe zu vermeiden. In der Praxis ist dies aber nicht immer umsetzbar (z. B. bei chirurgischen Eingriffen), sodass häufig auf einfachblinde Studiendesigns zurückgegriffen wird.1angelehnt an Weiß, Christel (2013): Studien zu Therapie und Prognose. In: Christel Weiß (Hg.): Basiswissen Medizinische Statistik. Mit 20 Tabellen. 6., überarbeitete Auflage. Berlin, Heidelberg: Springer (Springer-Lehrbuch), S. 275–294, Kapitel 15 und Schulgen/Kristiansen, Gabi, Schmoor, Claudia (2008). Randomisation und Verblindung. In: Methodik klinischer Studien. Methodische Grundlagen der Planung, Durchführung und Auswertung. Martin Schumacher, Gabi Schulgen (Hrg.), 3. Aufl., Springer Verlag, S. 195-205, Kapitel 11.![]()
Ähnliche Einträge
Fußnoten
- 1angelehnt an Weiß, Christel (2013): Studien zu Therapie und Prognose. In: Christel Weiß (Hg.): Basiswissen Medizinische Statistik. Mit 20 Tabellen. 6., überarbeitete Auflage. Berlin, Heidelberg: Springer (Springer-Lehrbuch), S. 275–294, Kapitel 15 und Schulgen/Kristiansen, Gabi, Schmoor, Claudia (2008). Randomisation und Verblindung. In: Methodik klinischer Studien. Methodische Grundlagen der Planung, Durchführung und Auswertung. Martin Schumacher, Gabi Schulgen (Hrg.), 3. Aufl., Springer Verlag, S. 195-205, Kapitel 11.