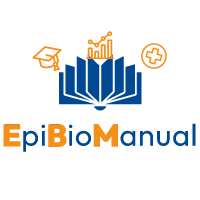p-Wert
Begriff im Kontext statistischer Tests. Beschreibt die Wahrscheinlichkeit, dass bei Gültigkeit der Nullhypothese die beobachtete Teststatistik oder sogar ein noch extremeres Ergebnis eintritt. Je kleiner der -Wert ist, desto mehr spricht dies folglich für die Ablehnung der Nullhypothese. Ist der -Wert kleiner als das vorher festgelegte Signifikanzniveau wird von einem signifikanten Ergebnis gesprochen. Folglich wird der -Wert verwendet, um eine logisch nachvollziehbare und objektive Entscheidung für Null- oder Alternativhypothese zu fällen. Er ergibt sich aus der Fläche unter der dem Testverfahren zugrundeliegenden Verteilung vom Wert der Teststatistik bis zu ihren Rändern.angelehnt an Weiß, Christel (2013): Prinzip eines statistischen Test. In: Christel Weiß (Hg.): Basiswissen Medizinische Statistik. Mit 20 Tabellen. 6., überarbeitete Auflage. Berlin, Heidelberg: Springer (Springer-Lehrbuch), S. 161-177, Kapitel 9.[/katex]